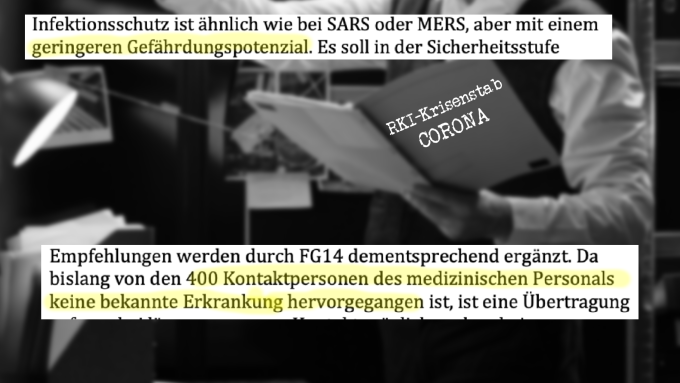Studie belegt: 53% der 'Transkinder'-Mütter mit Borderline-Störung oder Depression
 Ängstliche Frau: Freepik; Trans-Mutter: Ted Eytan, Flickr, CC BY-SA 2.0 (Symbolbilder); Komposition: Der Status.
Ängstliche Frau: Freepik; Trans-Mutter: Ted Eytan, Flickr, CC BY-SA 2.0 (Symbolbilder); Komposition: Der Status.
Diese Studie hat es in sich und bestätigt das, was viele bereits ahnten: Bei den Müttern von als "Transkinder" bezeichneten Buben zeigen sich weit überdurchschnittlich häufig Probleme mit der mentalen Gesundheit. Besonders häufig wurden dabei Borderline-Störungen sowie diverse Depressionserkrankungen identifiziert. Zudem wurde herausgefunden, dass die Mütter der Probanden - womöglich infolgedessen - zu Erziehungspraktiken neigen, welche die Entwicklung ihrer Kinder zu einem unabhängigen Menschen behindern. Dass die Betroffenen ihr kindliches Trauma womöglich durch ein Nachstellen der Rolle der weiblichen Bezugsperson lediglich psychosozial verarbeiten wollen, scheint plausibel.
53% der Mütter mit Borderline oder Depression
Die gewonnenen Erkenntnisse sind nicht neu, im Gegenteil: Denn die Studie wurde bereits im Jahr 1991 publiziert. Dabei wurde die psychologische Auffälligkeit in Familien mit Buben, die unter einer "Störung der Geschlechtsidentität" beleuchtet. Die Ergebnisse waren schockierend: Während in der Kontrollgruppe vergleichsweise geringe 6 Prozent der Mütter eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder depressive Symptomatik aufwiesen, waren dies bei den "Transkinder-Müttern" sage und schreibe 53 Prozent, also mehr als die Hälfte.
Das Alter der Studie ist hier umso beachtlicher, da sie in eine Zeit fällt, als die Trans-Agenda noch nicht die politische Debatte derart beherrschte wie heutzutage. Damit kann ein "reporting bias", bei dem die Autoren bestrebt sind, Ergebnisse zu liefern, die ihnen Applaus in der öffentlichen Wahrnehmung bietet, praktisch ausgeschlossen werden. Auffällig ist, dass die untersuchten Frauen - entsprechend ihrer Borderline-Veranlagung - zur Forcierung einer symbiotischen Eltern-Kind-Beziehung neigten. Dabei verschmelzen sie die Psyche mit der ihres Kindes, als wäre es ein eigenes Körperteil. Dadurch erlernen die Kinder keine Eigenständigkeit.
Study shows that 53% of mothers of boys with Gender Identity Disorder (GID) have borderline personality disorder or depression
— Ashley St. Clair (@stclairashley) June 5, 2023
These mothers also had child-rearing attitudes and practices that encouraged symbiosis and discouraged the development of autonomy.… pic.twitter.com/krOOfQKxbj
Beidseitige Trennungsängste als Zunder
Dieser übersteigerte "Wir"-Begriff führt laut unabhängigen Erziehungsexperten dazu, dass die Kinder ihn zuerst als Zuwendung wahrnehmen. Da diese ein Grundbedürfnis darstellt, lernen sie schnell: Sowohl sein Kooperations- als auch sein Verweigerungsverhalten führt zu noch mehr Zuwendung. Es erlebt die elterliche Welt als ohnmächtig und begreift sich selbst als mächtig. Tatsächlich kann sich dies in einer von zwei Formen äußern: Entweder werden elterliche Vorgaben prinzipiell konterkariert, um deren Zuneigung zu erhalten - oder sie heischen nach dieser, in dem sie deren Wünsche und Vorstellungen umso deutlicher erfüllen, selbst wenn dies eigentlich nicht in ihrer Macht steht.
Daraus ableiten lassen sich zwei typische Verhaltensmuster. Im Zuge einer Identitätskrise, die im frühpubertären Alter nicht zwingend pathologisch sein muss, fühlen sie sich etwa durch ihr Umfeld missverstanden. Sie verabscheuen sogar die Geschlechtsidentität und den Taufnamen, in der Folge versucht die Mutter ihr Kind noch mehr zu verhätscheln. Oder sie merken, dass ihre Mutter lieber ein Mädchen statt einen Jungen gehabt hätte und wollen ihrer nahen Bezugsperson gefallen, indem sie die vermeintlich erwünschte Geschlechtsidentität annehmen. Eine weitere Studie wies 1996 eine hohe Rate von pathologischen Trennungsängsten bei Buben mit gestörter Geschlechtsidentität nach.
Nun folgen oftmals mitunter gegenseitige Bestätigungsrituale, deren Anerkennung auch auf das Umfeld projiziert wird. Im manischen Geltungsbedürfnis, die Zuneigung zu beweisen, befördern sie die neue vermeintliche "Transidentität" ihres Kindes über Gebühr und tragen diese mitunter in die Öffentlichkeit. Die Aufmerksamkeit - und im aktuellen gesellschaftlichen Klima - gesellschaftliche Sonderstellung wäre demnach die Erweiterung ihres eigenen Bedürfnisses nach der Vertiefung einer bereits pathologischen Mutter-Kind-Beziehung. Am Ende tanzen Kinder- die ja ohnehin gerne im Mittelpunkt stehen - dann mitunter als prä- oder frühpubertäre "Dragqueens" vor Erwachsenen.
Nicht nur eine verschrobene Kunstform, sondern gefährlich - Kinder in mitunter sexualisierter Kleidung & Tanzformen könnten auch Pädophile anlocken:
Teufelskreis der Persönlichkeits-Störung
Die Verbindung zur psychologischen Auffälligkeit ist offenkundig: Für Borderline-Patienten sind intensive, aber instabile persönliche Beziehungen auch im engsten Umfeld typisch. Die Angst vor Zurückweisung ist bei "Borderlinern" sogar höher als bei Menschen mit schweren Sozialphobien, Borderline-Mütter reagieren empfindlicher auf Trennungs-Situationen von ihrem Kind. Dazu kommt eine hohe Inzidenz gestörter Selbstbilder & Selbstwahrnehmungen. Mütter, die an ihrem Ich zweifeln, könnten dies an ihr Kind weitergeben, was in Kombination mit der "symbiotischen Beziehung" zur toxischen Situation führen kann, in der das Kind eigene Identitätszweifel als Wunschverhalten ansieht.
Zusätzlich sind klinische Depressionen eine häufige komorbide Erscheinung bei Borderline-Patienten. Diese äußern sich bei diesen noch häufiger in Feindseligkeit sowie deutlich negativere Selbstbilder. Ihre depressiven Symptome haben häufiger mit interpersonellen Situationen zu tun, als bei Depressiven ohne Borderline-Syndrom. Zu allem Überdruss kann das Krankheitsbild erblich sein, sodass dieses bis zu 40% erblich ist. Auch Umwelteinflüsse wie ein feindseliges bis gestörtes Elternverhältnis spielen eine Rolle, was wiederum bei Borderlinern umso häufiger ist. Eine Mutter mit übertriebener Kindesbindung trifft womöglich auf ihr Kind, das Ansätze derselben Veranlagung aufweist - ein Teufelskreis.
Mobbing nicht Folge, sondern Mitauslöser?
Weitere wird insbesondere mütterliche Depression im Vorschulalter mit erhöhtem Auftreten von Störungen der kindlichen Entwicklung assoziiert. Da sich dies über Jahre hinweg auch auf die schulische Leistungsfähigkeit sowie die körperliche Gesundheit auswirken kann, können weitere Begleiterscheinungen auftauchen. Dadurch können sie auch leichter zum Außenseiter werden. Das erhöhte Risiko von Kindern mit gestörter Geschlechtsidentität, von Mitschülern gemobbt zu werden, wird in diesen Zeiten häufig als angeblicher Beweis für "transphobe" Verhaltensmuster interpretiert, die auf die sozial erwünschte Beibehaltung der heteronormativen Identität abziele.
Offenbar wird hier vor dem Hintergrund akademisch "erwünschter" Interpretation ein Fehlschluss gezogen. Denn gerade bereits zuvor bestehendes Mobbing kann erneut zu starken Verunsicherungen der Kinder, sozialer Abkapselung und einem gestörten Verhältnis zur eigenen Identität führen, die wiederum bei bereits bestehender "Vorbedingung" umso heftiger ausschlagen können. Dabei wäre dann eine "Transidentität" womöglich sogar der Wunsch, aus diesem Teufelskreis gestörter Beziehungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Familie auszubrechen. Der als Frau geborene Schauspieler Elliot Page gab sogar selbst zu, dass Schul-Mobbing die eigene Gender-Identitätsstörung verstärkte.
+++ Folgt uns auf Telegram: t.me/DerStatus +++